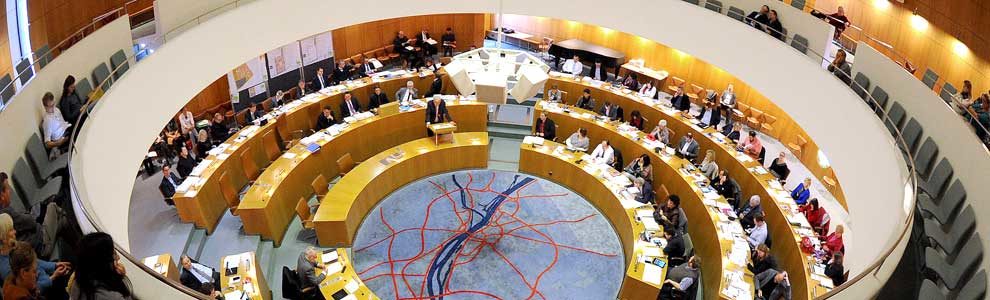Umwelttipp: Prima Klima im Garten
Ohne Zweifel zeigen sich Klimaveränderungen in Deutschland durch steigende Temperaturen, neue Niederschlagsmuster und eine Zunahme extremer Wetterereignisse wie Hitzewellen mit Starkregen und lokalen Dürren. Gerade Privat- und Kleingärten haben teils ungeahnte und ungenutzte Qualitäten für den Klimaschutz in der Stadt und am Stadtrand. Ihre Gesamtfläche umfasst ca. 976.000 Hektar, was etwa 2,6% der Fläche Deutschlands ausmacht. Da sie uns direkt umgeben, wirkt sich ein klimaangepasstes Gärtnern unmittelbar positiv auf die Umgebung aus und trägt zum globalen Klimaschutz bei.
Klimarelevanz von Privat- und Kleingärten
Durch ihre Vegetation und Verdunstung sorgen Gärten für eine lokale Abkühlung, insbesondere nachts. Die Kühlungseffekte sind oft stärker als in Parkanlagen, da sie eine dichtere Vegetation und regelmäßige Bewässerung aufweisen. Ihre Grünflächen fördern den Luftaustausch und können als Frischluftschneisen wirken, was zur Verbesserung des städtischen Klimas beiträgt. Die Vegetation speichert CO2 in ihrer Biomasse, was sich positiv auf das globale Klima auswirkt. Privat- und Kleingärten bieten wichtige Lebensräume für Pflanzen und Tiere und tragen so zur Artenvielfalt in der Stadt bei. Gärten können die Hitzevorsorge in der Stadt wesentlich unterstützen, denn Regenwasser versickert vor Ort oder wird zurückgehalten. Damit unser Garten die oben genannten Effekte bewirken kann, gibt es Folgendes zu beachten.
Gutes Klima durch gutes Bodenmanagement
Die Grundlage für einen klimawirksamen Garten bildet ein guter Boden. Nur lockerer, krümeliger Boden führt zu üppigem Pflanzenwachstum. Er speichert Wasser und Nährstoffe optimal und lässt gleichzeitig überschüssiges Wasser gut abfließen. Die Bodenlebewesen finden hier ideale Bedingungen vor und sorgen für eine gute Humusbildung. Die neuen „Feinde“ heißen nämlich Trockenheit und Starkregen. Neben schweren Böden, häufigem Begehen, Mangel an organischem Material oder falscher Bewirtschaftung führen diese Klimawandelfolgen zu einer Verdichtung des Bodens.
Bei Trockenheit verhärtet er schnell und es bilden sich Risse. Die Pflanzen können weder ausreichend Wasser noch Nährstoffe aufnehmen. Ihr Wachstum wird dadurch stark gehemmt. Die Wurzeln können nicht mehr tief genug in den Boden eindringen, um Wasser, Sauerstoff und Nährstoffe aufzunehmen. Bei Starkregen prasseln große Wassertropfen mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden. Sie zerstören die Bodenstruktur an der Oberfläche und wertvoller Humus wird abgetragen. Ähnliches passiert bei falscher Bewässerung mit dem Gartenschlauch. Wird mit zu hohem Druck gegossen, verdichtet sich der Boden. Als Folge von Bodenverdichtung verkümmern die Pflanzen. Wir müssen also einer Bodenverdichtung entgegenwirken, die die natürliche Struktur des Bodens zerstört und die Hohlräume zwischen den Bodenpartikeln zusammenpresst.
Um die Bodenstruktur zu verbessern, arbeiten wir Gärtner:innen Kompost, Sand und Gründüngung ein. Humus und andere organische Stoffe sorgen für eine lockere, krümelige Struktur. Sie verbessern die Wasserspeicherfähigkeit und verhindern, dass der Boden bei Trockenheit zu stark verhärtet. Regelmäßiges Mulchen mit Mähgut und die Zugabe von Kompost beugen Verdichtungen vor. Den Boden bearbeiten Sie schonend mit Werkzeugen wie der Grabgabel oder dem Sauzahn. Und beim Gießen auf eine sanfte, feine Bewässerung achten.
Wassermangel entgegenwirken
Im Zuge der Klimaveränderungen verschiebt und verlängert sich die Vegetationszeit, die Winter werden trockener und bereits im Frühjahr können Hitzeperioden auftreten. Darum wird auch das Wassermanagement in unserem Garten immer wichtiger.
Wasser speichern zum Gießen gelingt mithilfe von Regentonnen, Wassertanks oder Zisternen. So kann der Wasserbedarf für das ganze Jahr gedeckt werden. Wasser sollte auf dem Grundstück versickern und zurückgehalten werden, damit es den Pflanzen zur Verfügung steht und auch bis ins Grundwasser gelangt. Hierfür eignen sich natürliche Senken, wohin das Regenwasser geleitet werden kann. Versiegelte Flächen, Einfahrten und Wege können z.B. durch Rasengittersteine, Kies, Rindenmulch oder Rasenwege ersetzt werden.
Stellen mit höherer Wasserhaltefähigkeit sind Ecken oder Plätze im Garten, die mit Laub, Nadeln oder Moos bedeckt sind. Diese können vermehrt Wasser aufnehmen und halten. Der Boden bleibt an diesen Stellen feucht und wirkt klimaregulierend, da die Luftfeuchtigkeit erhöht wird.
Nachhaltig klimawirksam bepflanzen
Klimaangepasste Pflanzen sollten die Hauptrolle in unserem Garten spielen, denn sie verbessern das Mikroklima, spenden Schatten, produzieren Sauerstoff, schützen den Boden und bieten Nahrung und Lebensraum für Tiere.
Gerade auf Bäume trifft das o.g. besonders zu. Über die Blätter verdunsten sie Wasser und kühlen damit die Umgebung. Gleichzeitig belüften ihre weit verzweigten Wurzeln den Boden und ermöglichen, dass Niederschlag das Grundwasser erreichen kann. Bei Hitze lässt es sich unter ihrem Blätterdach gut aushalten.
Sträucher und Hecken: In ihrem Windschatten ist die Taubildung höher und der Boden feuchter. Den effektivsten Windschutz bietet eine mehrreihige Wildstrauchhecke (mind. 3m) die frei wachsen darf.
Krautige Pflanzen sind die kostenlose Klimaanlage im Garten. Über ihre Blätter verdunsten sie Wasser, mit dem Effekt, dass die Umgebungsluft gekühlt und befeuchtet wird. Pflanzen verhindern auch, dass der Boden austrocknet und durch Wind und Regen abgetragen wird. Je vielfältiger die Artenauswahl, desto kleiner ist das Risiko, dass viele Pflanzen gleichzeitig ausfallen. Heimische Pflanzen sollten den Vorzug haben.
Teiche oder Sumpfbeete sind bei Hitze eine willkommene Trinkstelle für Insekten & Co. und bieten wassergebundenen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. Sie speichern zudem Kohlenstoff und kühlen durch Verdunstung aus der Wasserfläche und den Pflanzen die Umgebung.
Eine Wiese mit heimischen standortgerechten Wildblumen und Wiesengräsern übersteht trockene Phasen ohne Gießen und braucht kaum Pflege. Ihre tief reichenden Wurzeln schützen bei Wind und Starkregen den Boden vor Erosion.
Hügel und Senken gliedern den Garten in trockene und feuchte Bereiche. Regenwasser lässt sich dadurch - etwa in ein Sickerbeet - leiten und Starkregenereignisse abpuffern. Hügel bremsen den Wind und schützen vor Austrocknung. Werden sie bepflanzt, verstärkt sich der Effekt. Kraterbeete bieten verschiedene Zonen - auf dem Wall und an den Hängen ist es trockener, im Inneren feuchter. Eine Anleitung zum Bau siehe Linkliste.